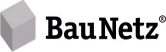https://www.baunetz.de/recht/Architekturfotografie_Benennung_des_Fotografen_erforderlich__9710654.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Einschnitte mit Ausblick
Bürohochhaus von BAX in Ljubljana
Trainspotting in Oberau
Wohnhaus in Bayern von Büro Dantele und Kofink Schels
Wohnen und Arbeiten in der Kaserne
Umbau in Moncenisio von Antoni de Rossi, Laura Mascino, Matteo Tempestini und Coutan Architects
Das Beste aus den Amerikas
Finalisten des Mies Crown Hall Americas Prize 2025 bekanntgegeben
Ökologie und Soziales zusammenbringen
Zukunft Bau Kongress 2025 in Bonn und online
Radikale Einfachheit
BAUNETZWOCHE#664
Leuchtturm im Industriegebiet
Theater in Brescia von Botticini + Facchinelli ARW
Architekturfotografie: Benennung des Fotografen erforderlich!
Eine schuldhafte Urheberrechtsverletzung kann darin bestehen, dass ein Architekt auf seiner Homepage Fotografien öffentlich zugänglich macht, ohne den Fotografen als Urheber des Lichtbildwerkes zu benennen.
Hintergrund
Werke des Architekten sind urheberrechtsschutzfähig.
Voraussetzung dafür, dass einem bestimmten Werk Urheberrechtsschutz zuerkannt werden kann, ist, dass das Werk eine persönliche geistige Schöpfung darstellt.
Werke des Architekten sind urheberrechtsschutzfähig.
Voraussetzung dafür, dass einem bestimmten Werk Urheberrechtsschutz zuerkannt werden kann, ist, dass das Werk eine persönliche geistige Schöpfung darstellt.
Beispiel
(nach OLG Hamburg , Urt. v. 02.05.2024 - 5 U 108/23)
(nach OLG Hamburg , Urt. v. 02.05.2024 - 5 U 108/23)
Ein Architekt nutzt zu Referenzzwecken auf seiner Homepage insgesamt 5 Fotografien eines selbstständigen Fotografen ohne Urheberbenennung, welcher diese für einen anderen Auftraggeber als Fotoserie „Gymnasium XY“ anfertigte. Der Fotograf verlangt Schadensersatz von dem Architekten. Der Architekt macht unter anderem geltend, dass andere Lizenznehmer der Fotoserie „Gymnasium XY“ nicht verpflichtet gewesen seien, den Kläger als Urheber der Fotos zu benennen. Im Übrigen habe die fehlende Urhebernennung nicht zu einem Vermögensschaden in Form entgangener Folgeaufträge geführt, da die Fotos schon aufgrund ihrer schlechten Bildqualität nicht geeignet gewesen seien, dem Kläger Folgeaufträge zu bescheren.
Das Oberlandesgericht Hamburg gibt der Klage des Fotografen statt. Dem Fotografen stehe hier gemäß § 97 Abs. 2 UrhG gegen den Architekten wegen der Nutzung der 5 bezeichneten Fotografien, bei denen es sich unbestritten um vom Fotografen geschaffene Lichtbildwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 UrhG handele, dem Grunde nach der geltend gemachte Anspruch auf Schadensersatz zu. Der Architekt habe die Urheberrechte des Fotografen schuldhaft, nämlich jedenfalls fahrlässig verletzt, indem er diese 5 Fotografien in der angegriffenen Weise auf seiner Homepage gemäß § 19a UrhG öffentlich zugänglich gemacht habe. Der Architekt behaupte selbst kein Recht zur Nutzung der Fotografien.
Festzustellen sei des Weiteren, dass der Architekt sich im Hinblick auf die unstreitig fehlende Urheberbenennung im Sinne des § 13 UrhG auch nicht mit Erfolg darauf berufen könne, dass der Fotograf hinsichtlich der 5 streitgegenständlichen Bilder auf sein Urheberbenennungsrecht verzichtet habe. Es sei entgegen der Ansicht des Architekten nicht verlässlich festzustellen, dass der Fotograf im Rahmen eines etwaigen Lizenzvertrages auch gegenüber dem Architekten auf eine Benennung als Urheber verzichtet hätte. Auch das Argument der schlechten Bildqualität greife nicht durch, eine Werbewirkung ergebe sich in jedem Fall schon allein aus dem Umstand, dass bekannt gemacht werde, dass der Fotograf im Bereich der Architekturfotografie tätig sei. Zudem belege auch die Tatsache, dass der Architekt die streitgegenständlichen Fotos auf seiner Homepage zu Referenzzwecken genutzt habe, deren grundsätzliche Eignung zum werblichen Einsatz.
Das Oberlandesgericht Hamburg gibt der Klage des Fotografen statt. Dem Fotografen stehe hier gemäß § 97 Abs. 2 UrhG gegen den Architekten wegen der Nutzung der 5 bezeichneten Fotografien, bei denen es sich unbestritten um vom Fotografen geschaffene Lichtbildwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 UrhG handele, dem Grunde nach der geltend gemachte Anspruch auf Schadensersatz zu. Der Architekt habe die Urheberrechte des Fotografen schuldhaft, nämlich jedenfalls fahrlässig verletzt, indem er diese 5 Fotografien in der angegriffenen Weise auf seiner Homepage gemäß § 19a UrhG öffentlich zugänglich gemacht habe. Der Architekt behaupte selbst kein Recht zur Nutzung der Fotografien.
Festzustellen sei des Weiteren, dass der Architekt sich im Hinblick auf die unstreitig fehlende Urheberbenennung im Sinne des § 13 UrhG auch nicht mit Erfolg darauf berufen könne, dass der Fotograf hinsichtlich der 5 streitgegenständlichen Bilder auf sein Urheberbenennungsrecht verzichtet habe. Es sei entgegen der Ansicht des Architekten nicht verlässlich festzustellen, dass der Fotograf im Rahmen eines etwaigen Lizenzvertrages auch gegenüber dem Architekten auf eine Benennung als Urheber verzichtet hätte. Auch das Argument der schlechten Bildqualität greife nicht durch, eine Werbewirkung ergebe sich in jedem Fall schon allein aus dem Umstand, dass bekannt gemacht werde, dass der Fotograf im Bereich der Architekturfotografie tätig sei. Zudem belege auch die Tatsache, dass der Architekt die streitgegenständlichen Fotos auf seiner Homepage zu Referenzzwecken genutzt habe, deren grundsätzliche Eignung zum werblichen Einsatz.
Hinweis
Im Übrigen streiten die Parteien insbesondere über die Höhe des im Rahmen der Lizenzanalogie geschuldeten Schadensersatzes. Hierzu weist das Oberlandesgericht Hamburg auf Folgendes hin: Der Anspruch auf Schadensersatz für die Verletzung des Rechtes der öffentlichen Zugänglichmachung richtet sich bei seiner Berechnung im Wege der Lizenzanalogie auf den Betrag, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte. Bei der Bemessung ist zu fragen, was vernünftige Vertragsparteien als Vergütung für die vorgenommenen Benutzungshandlungen vereinbart hat. Maßgebliche Bedeutung für die Bemessung kommt einer zur Zeit der Verletzungshandlung am Markt durchgesetzten eigenen Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers zu. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die in den Lizenzverträgen aufgeführten Lizenzsätze allgemein üblich und objektiv angemessen sind. Soweit der Rechtsinhaber die von ihm vorgesehenen Lizenzgebühren verlange und auch erhalte, rechtfertige dieser Umstand die Feststellung, dass vernünftige Vertragsparteien bei Einräumung einer vertraglichen Lizenz eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten. Fehlt es an einer eigenen am Markt durchgesetzten Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers, liege es nahe, branchenübliche Vergütungssätze und Tarife als Maßstab heranzuziehen, wenn sich in dem maßgeblichen Zeitraum eine solche Übung herausgebildet habe. Ist auch eine solche nicht feststellbar, ist die Höhe gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung des Tatgerichts zu bemessen.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Kanzlei:
Rechtsanwälte Reuter Grüttner Schenck