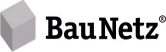- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
23.04.2025
Buchtipp: Triumph der moderaten Reform
Wohnungsbau im Atlas Ruhrgebiet
Gibt es ein cooleres Format unter den didaktischen Büchern als den Atlas? Sicher nicht. Erst recht, wenn man ihn so anlegt, wie es die Architekt*innen Moritz Henkel, Anna Jessen und Ingemar Vollenweider mit dem Atlas Ruhrgebiet. Von der Arbeitersiedlung bis zum experimentellen Wohnungsbau taten. Gerade weil sie keine vollständige Genealogie des Wohnens im Ruhrgebiet vorlegen, gelingt ihnen ein lehrreicher, aber ebenso kurzweiliger Einblick in die regionalen Eigenheiten.
Warum überhaupt das Ruhrgebiet? Ganz einfach: An der TU Dortmund befindet sich schlichtweg der Lehrstuhl der drei Herausgeber*innen. Schon Joseph Paul Kleihues untersuchte hier Ende der 1970er Jahre die Arbeitersiedlungen als paradigmatischen Typus der Region. Zum anderen hat die Industrialisierung, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts Millionen Menschen in den heute 5,1 Millionen Einwohner*innen zählenden Ballungsraum zog, später eingesetzt als etwa in den Industriezentren Frankreichs oder Englands. Daher konnte man in Sachen Massenwohnungsbau bereits von dortigen Versuchen lernen, so Henkel.
Es sei die moderate Reform gewesen, die im Ruhrgebiet zum Erfolgsrezept avancierte. Kein harter Bruch, sondern gezielte Anpassungen von – im wahrsten Sinne – gewohnten Formen. Wagemutige Experimente hingegen setzten sich im Pott langfristig nicht durch. Zu den prominentesten Beispielen gehört die Metastadt in Dorsten-Wulfen, die nach nur zwölf Jahren wieder abgerissen wurde. Das Schicksal derart avantgardistischer Projekte, unter die auch das ebenfalls in Dorsten realisierte Habiflex von Richard Gottlob und Horst Klement fällt, liegt in der Bauphysik.
Ihr politisches Anliegen, die individuelle Aneignung erneut im sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen, hat hingegen heute in Konzepten wie Schalträumen oder Rohbau-Ästhetik wieder Konjunktur. Die extreme Flexibilität sorgte allerdings für undichte Dächer, Fassaden und Wärmebrücken en masse. Das Habiflex etwa führte den sogenannten Gelsenkirchener Balkon ein. Durch faltbare Fenstertüren konnte dieser wahlweise dem Innen- oder Außenraum zugeschlagen werden – in der Theorie ein interessantes Konzept, in der Umsetzung ein bauphysikalisches Desaster. Aktuell steht der Bau leer und kurz vor dem Abriss.
Derartige Einblicke, die einen Bogen zwischen der ursprünglichen Vision und ihrer heutigen Wirkkraft schlagen, ziehen sich durch die gesamte Publikation. Die Herausgeber*innen haben fünf Ruhrstadtmodelle definiert. Sie stellen sie anhand von insgesamt 14 Beispielen vor, die jeweils mit neu gezeichneten Plänen, ganzseitigen Axonometrien und Fotos von Detlef Podehl präsentiert werden. Die geringe Zahl der Projekte widerspricht einem Atlas prinzipiell. Dank der kurzen Essays vor jedem der fünf Kapitel entwickelt sich aber umso mehr ein Verständnis für den Ruhrgebietswohnungsbau.
So erklärt Henkel die Entstehung der Arbeitersiedlungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts als erste Reaktion auf den enormen Wohnungsbedarf im Zuge des explodierenden Bergbaus. Schon dieser Siedlungstyp zeigt sich retrospektiv als eine Art „resistente Kreuzung“ aus Neuem und Bekanntem, wie es Jessen und Vollenweider anschaulich beschreiben. Man versuchte, den meist vom Land zugezogenen Arbeiterfamilien die Anpassung zu erleichtern, indem etwa bekannte Motive aus dem Heimatstil zitiert wurden. Zudem bot man Gärten für die Kleintierhaltung oder Gemüseanbau an, die nicht nur der Selbstversorgung, sondern auch der Freizeit dienten. Parallel zeigt sich hier eine Art Vorläufer der offenen Stadtlandschaft. Locker verteilte Häuser, die keine eindeutige Aufteilung in öffentlichen Straßenraum und private Rückseite mehr kennen, sondern gleichwertig von allen Seiten erschlossen werden.
Weiter führt der übersichtliche historische Ritt durchs Ruhrgebiet zu den Reformblöcken im frühen 20. Jahrhundert, die den städtischen Blockrand im Sinne besserer Hygiene gezielt weiterentwickelten. Wiederum nur einen kleinen Schritt weiter in Richtung autogerechter Stadt gingen daraufhin die 1950er Jahre, die anhand eines „auffällig unauffälligen Ensembles“ von Heinz Knäpper und Friedrich Riegels in Oberhausen beleuchtet werden.
Selbst die Beispiele aus der Zeit des experimentellen Wohnungsbaus der 1970er Jahre waren vor allem dann langfristig erfolgreich, wenn sie das Ungewohnte anschlussfähig zu gestalten wussten. Das Hügelhaus in Marl zeigt das exemplarisch. Anders als abstrakte Terrassenhäuser betteten Peter Faller und Hermann Schröder die große Masse hier in die bekannte Figur des Satteldachs. Etwa zur gleichen Zeit entstanden Großwohnsiedlungen, in denen Architekt*innen „lebensbejahende Urbanität“ durch Vorfertigung und serielles Bauen erreichen wollten. Gerade hier lohnt sich der Appell, den die Herausgeber*innen mithilfe eines Zitats von Colin Rowe gleich an den Beginn ihres Atlasses stellen: Einen unvoreingenommenen Blick auf „Architekturen der guten Absicht“ zu richten.
Text: Maximilian Hinz
Atlas Ruhrgebiet. Von der Arbeitersiedlung bis zum experimentellen Wohnungsbau
Moritz Henkel, Anna Jessen, Ingemar Vollenweider, Lehrstuhl Städtebau, TU Dortmund (Hg.)
264 Seiten
Verlag Kettler, Dortmund 2024
ISBN 978-3-98741-168-7
48 Euro
Kommentare:
Meldung kommentieren

Vittinghoff-Siedlung in Gelsenkirchen von Alfons Fels

Habiflex in Dorsten von Richard Gottlob und Horst Klement

Siedlung Eisenheim in Oberhausen von Hermann Wilhelm Lueg

Ensemble an der Friedrich-Karl-Straße in Oberhausen von Heinz Knäpper und Friedrich Riegels
Bildergalerie ansehen: 11 Bilder