- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
19.06.2024
Abstrakte Kunst im Zuckerwürfel
Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden von Fumihiko Maki
8
arcseyler | 21.06.2024 09:39 Uhr.....
Die Grundkonzeption des Shop in Shop, wie bei der neuen Mannheimer Kunsthalle wird sichtbar. Allerdings ist das hohe Stadtfoyer wie in MA oder auch im Berliner Schloss hier als Lichthof ausgegrenzt. Eine vertane Chance für Wiesbaden. Insofern ist die letzte Entwicklung des öffentlichen Stadtraums noch nicht vollzogen, somit eher doch ein Rückblick.
Auch Bibliotheken, neuerdings in ehemaligen Kaufhäusern, entwickeln sich zu vielzweck Aufenthaltsräumen.
7
U919 | 20.06.2024 13:54 UhrAn joscic, Werke, sehe Wikipedia...
Memorial Hall Auditorium der Universität Nagoya (1960, Nagoya)
Eigenes Haus (1978, Tokio)
Makuhari-Messe (1989, Chiba)
Shonan Fujisawa Campus der KeiÅ-Universität (1990, Fujisawa)
Yerba Buena Center for the Arts (1993, San Francisco)
Büropark Isar (1994, Hallbergmoos[6] bei München)
Ensemble Global Gate (2000–2006, Düsseldorf)
Bürogebäude Solitaire (2001, Düsseldorf)
Bürogebäude des Senders TV Asahi (2003, Tokio)
Four World Trade Center, Neubaugebäude am Ground Zero in New York City (2008–2013)
Gate of Taipei, Taipeh, Taiwan (2009–2013)
Museum Reinhard Ernst, Wiesbaden (geplante Eröffnung 23. Juni 2024)[7]
6
An Nummer 1 | 20.06.2024 11:20 UhrAlso
Zu behaupten, dass man "halbwegs gut informiert" sei, und dann Maki NICHT kennt ist ja ein Paradoxon. Dann ist man halt doch nicht informiert - auch nicht halb. Selbsteinschätzung kann auch Überschätzung sein.
Maki, war und ist eine wichtige Figur in der Architektur, der viele seiner Kollegen inspiriert hat. Darüber hinaus sollte man Wissen hier nicht mit Geschmack verwechseln und dann irgendwelche ignoranten Urteile auf letzterem basierend raus zuhauen, obwohl man gerade festgestellt hat, dass man Maki nicht wirklich kennt. Das zeugt auch nicht gerade von gut verlinkten Synapsen.
Und dann: seit wann ist den Maki weiß? Wenn man sich schon in die Welt der ethnischen Klischees begibt, dann sollte man doch bemerkt haben, dass Maki in Japan geboren wurden und im schematischen ethnischen Denken unserer Zeit nicht als weiß gilt.
Manchmal nützt Wissen ja dann doch etwas. Es gibt auch einen fundamentalen Unterschied zwischen Wissen und „Information“ (ob nun halb oder ganz).
4
Lars K | 20.06.2024 08:20 UhrGenius Loci
Nur ganz kurz zum Thema Genius Loci:Wer Wiesbaden kennt, der weiß, dass das neue Museum kein Maßstabssprenger ist. Wenn man vom Hbf über die Friedrich-Ebert-Strasse läuft, die scheussliche Lärmschneise, dann läuft man fast ununterbrochen an dicken Klopsen vorbei: Finanzministerium, Contipark, Landesmuseum und -ganz schlimm- Kongresszentrum. Da schiebt sich das MRE zwar etwas aus den Baufluchten und gerät dadurch früher in den Blick, was aber nur gut tut. Von den genannten Gebäuden ist das MRE in jedem Fall das mit dem höchsten Anspruch. ich finds gut. Muss aber erst noch rein. Willkommen in Wiesbaden.
3
Genius_loci | 20.06.2024 01:10 UhrWhite cubes
Ein irgendwie merkwürdiges Ensemble, klobig und eigenwillig proportioniert. Ein wuchtiges Implantat im Stadtraum, maßstabslos und vermeintlich ohne Bezüge zu seiner Umgebung. Das kann bei einem Museum als Sonderbau legitim sein, wirkt hier aber weder elegant noch repräsentativ.
Beeindruckend der konstruktive Aufwand für das gläserne EG, der Gewinn daraus hält sich in Grenzen. Zumindest lässt er die Zuckerwürfel etwas schweben.
Ich befürchte, dass das Gebäude mit dieser DNA nicht gut altern wird.
Innenräumlich zeigt das "MRE" deutlich mehr Qualitäten, löst den Anspruch eines Museums ein.
Auch wenn mich das Gesamtergebnis nicht recht überzeugen kann, ist das "geschenkte" Haus in jedem Fall ein Gewinn für die Stadt. Erst recht, wenn man die frühere Nutzung des Grundstücks (Bild 35!) dagegenhält.
2
Guten Abend | 19.06.2024 22:41 UhrGute Besserung
Geehrter Vorredner,
warum soll ein Mäzen einen Wettbewerb machen, wenn er weiß, was er will ? Warum soll er sich mit einer zeitgenössischen Architektin konfrontieren, wenn er seinen Planer schon gefunden hat ? Wieviel Steuern hat er bezahlt ? Kein Mensch muss eine Stiftung gründen und ein Museum bauen. Die Gesetze zu Stiftungen macht die öffentliche Hand. Dieses Geschwurbel und Neiddebatten sind so verachtenswert (und westdeutsch). Das braucht keiner. Es ist ein großartiges Projekt und jede Kommune kann sich glücklich schätzen, so einen Städtebau- Schatz zu bekommen.
1
joscic | 19.06.2024 18:18 UhrRares für Bares
Ich halte mich was Architektur betrifft für halbwegs gut informiert, aber von Fumihiko Maki hatte ich bis zur Meldung seines Todes vor ein paar Tagen noch nicht gehört. Keines der gezeigten Gebäude war mir bekannt und ich finde auch keines davon besonders herausragend. Vielleicht waren die Häuser aus den 80er Jahren zu ihrer Zeit noch Avantgarde. Vielleicht haben Richard Meyer und Peter Eisenman ja auch bei ihm abgeschaut. Was an seiner Architektur aber besonders menschlich sein soll ist mir unverständlich. Interessant wäre ja dann vielleicht eher unmenschliche Architektur.
Das vermeldete Gebäude hat den Charme einer Bank oder eines Verwaltungsgebäudes der Firma Harmonic Drive (mit der Herr Ernst sein Geld verdient hat), da nützt auch die verborgene "Stahlskulptur" und die CO2 sparende Hakenplatten Fassade nichts. Der Grundriss erscheint mir künstlich verwinkelt und verschachtelt mit dem Ergebnis, daß die Skulptur von Toni Cragg auf Bild 18 unglücklich in einer Nische eingezwängt steht. Und nichts gegen alte weiße Pritzker Preis Träger, aber an dieser Stelle hätte doch eine zeitgenössische Architektin antreten können oder wenigstens ein Wettbewerb ausgelobt werden müssen - wenn schon drinnen auch nur bewährtes Werthaltiges nach Bauchgefühl und Farbe ausgewähltes steht.
Auch von Reinhard Ernst hatte ich noch nie etwas gehört. Seine Spannungswellengetriebe sollen ja bei den Mondautos eingebaut worden sein. Nichts gegen sein Stiftungsmodell, aber von den 80 Millionen wird die öffentliche Hand direkt oder indirekt einiges beigesteuert haben. Vielleicht wäre die Sammlung aber besser als Erweiterung in einem größeren Museum untergebracht gewesen. Jetzt steht da ein Museum Reinhard Ernst mit großen Namen zusammengewürfelt nach dem "Wow Effekt".



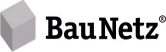









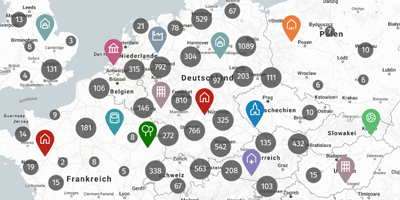










9
solong | 24.06.2024 12:48 Uhrmerkwürdige
aussenwirkung ... wirkt mit der zurückliegenden sockelzone ... eher wie ein kaufhaus der 70er-jahre ... kein "großer wurf"