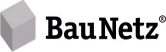- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
BAUNETZ
WOCHE
Das Querformat für Architekt*innen

Besondere Ausgaben




In Flandern sind in den vergangenen 15 Jahren Pflegeheime entstanden, die nicht allein wegen ihrer Gestaltung Vorbild sind. Sie entstanden in enger Kooperation mit der Träger-, Bauherr- und Nutzerschaft und gehen neue Wege in der Pflege von Jung und Alt. Wie ist es dazu gekommen?

Mit ihrem Lebenswerk verkörpert die pakistanische Architektin Yasmeen Lari auf exemplarische Weise die Bauwende. Einst entwarf sie repräsentative Betonbauten, später initiierte sie die weltweit größte Zero-Carbon-Selbstbau-Bewegung. Eine Ausstellung in Wien gibt erstmals einen Überblick über ihre Arbeit.

Im September eröffnete in Potsdam ein Museum, das der Kunst der DDR-Zeit gewidmet ist. Der Bau entstand als Kopie des einst beliebten Terrassenrestaurants Minsk am Brauhausberg und wird als Rettung der Ostmoderne gefeiert. Doch das ist nur ein Teil der außergewöhnlichen Geschichte des Ortes.

Hans Scharoun war eine Ausnahmefigur der Moderne und zentraler Protagonist des organischen Bauens in Deutschland. Architekt Ralf Bock und Fotograf Philippe Ruault haben sich intensiv mit der heutigen Nutzung von Scharouns Bauten beschäftigt. Ein Gespräch über engagierten Wohnungsbau, innovative Grundrisse und das Fotografieren komplexer Räume.

Vom dreckigen Industriekanal zur sauberen Flusslandschaft: Die Emscher wurde in den letzten drei Jahrzehnten umfassend renaturiert. Heute ist der Fluss im Ruhrgebiet abwasserfrei. Tiere und Pflanzen kehren zurück. Das ökologische und wasserwirtschaftliche Umbauprojekt ist das größte seiner Art in ganz Europa. Kürzlich wurde es abgeschlossen.

Die niederländische Planstadt Almere wird bald 50. Anfänglich setzten die Planer*innen auf kleinteilige Bebauung, die sich als Gegenentwurf zu den damaligen Großwohnsiedlungen verstand. In den Neunzigern konzipierten OMA ein ambitioniertes Stadtzentrum. Seit einigen Jahren versuchen nun MVRDV, auf einem riesigen Areal die Suburbia neu zu erfinden.

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar zeigt sich beispielhaft die starke Dynamik, mit der sich Afrikas Ballungsräume entwickeln. Ein Besuch vor Ort.

Ein Haus für Künstler*innen, ein Kraftwerk für Kreative, feministische Praxis in Berlin oder ein spätbarockes Belvedere: die Architekt*innen und Büros auf unserer Shortlist für 2023 zeichnen sich durch vielseitige Projekte ebenso wie ungewöhnliche Arbeitsweisen aus.

Was hat uns die Moderne heute noch zu sagen, und was bedeutet modern heute? Seit ihrer Gründung 1982 bestimmen diese Fragen die Arbeit der Stuttgarter Architekturgalerie am Weißenhof. Ein Blick auf vier bewegte Jahrzehnte.

Aller Kritik zum Trotz bieten Sportgroßereignisse auch Chancen und Geld, um nachhaltige Bauten zu entwickeln und neue Ansätze in der Stadtentwicklung auszuprobieren. Was konnte im Fall der umstrittenen Fussball-WM in Katar erreicht werden?

Alle sprechen von Resilienz, doch was heißt das für die Stadtentwicklung? Wir zeigen fünf Projekte, bei denen engagierte Bürger, Planerinnen, Ämter und Institutionen gemeinsam neue Wege ausprobieren. Zu Besuch in Stuttgart, Erlangen, Neuruppin, Aachen und Frankfurt am Main

Die weltweiten Krisen fordern das Rollenverständnis von Planern und Architektinnen heraus. Eine der drängenden Fragen lautet: Wem kommt ihre Arbeit zugute? Das Center for Public Interest Design in Portland hat eine klare Antwort und vielfältige Ansätze.

Seit über zehn Jahren versammelt der von Liechtenstein und der Schweiz ausgelobte Preis „Constructive Alps“ Vorzeigeprojekte einer länderübergreifenden alpinen Baukultur. Zeit für eine Tour in die Berge, zu schöner, suffizienter und klimagerechter Architektur in zunehmend fragiler Umgebung.

Zehn Jahre nach dem Tod von Günther Domenig fragt eine große Ausstellung in und um Klagenfurt nach der heutigen Relevanz des österreichischen Architekten. Wir zeigen drei Bildessays der Fotografen David Schreyer, Gerald Zugmann und Gerhard Maurer, die sich in ihrer Arbeit immer wieder mit Domenigs Bauten auseinandergesetzt haben.

Prishtina ist die jüngste Hauptstadt Europas. Der Kosovo eines der ärmsten Länder des Kontinents. Vor 23 Jahren endete der Krieg mit Serbien. Nun ist die europäische Wanderbiennale Manifesta zu Gast und lädt dazu ein, die Stadt und ihre Architektur zu entdecken.

Architekturspiele machen nicht nur Spaß. Sie helfen auch, neue Vorstellungen zukünftigen Bauens und Zusammenlebens zu entwickeln. Zum Potenzial des Spiels für die Architektur hat unsere Autorin in Wien die Ausstellung „Serious Fun. Architektur & Spiele“ kuratiert und ein gleichnamiges Buch veröffentlicht.

Als dichte Großwohnsiedlung aus Beton stieß das Olympische Dorf in München anfangs auf wenig Zustimmung. Doch das städtebauliche Experiment von 1972 ging auf und entfaltete nach und nach seine Qualitäten. Dazu zählen nicht nur üppige Grünräume, sondern auch eine starke, engagierte Nachbarschaft. Unser Autor lebt seit 30 Jahren im Olydorf.

Sechshundert. Die Zahl steht für die Kontinuität und den Erfolg der Baunetzwoche. Für diese Jubiläumsausgabe haben wir unser Archiv nach Themen durchsucht, deren Relevanz ungebrochen ist – und die Protagonisten von damals erneut befragt.

Neue Kulturstandorte auf ehemaligen Gewerbearealen jenseits der Innenstadt bringen frischen Wind in Münchens Stadtentwicklung. Mittlerweile findet man hier nicht nur Off-Szene und kreative Nischen, sondern auch etablierte Institutionen wie das Volkstheater und den Gasteig.

Barcelona verzeichnet eine Renaissance des engagierten Wohnungsbaus. Dabei rücken periphere Stadtviertel in den Fokus. Junge Büros entwerfen hier eine Architektur, in der sozial-ökologischer Anspruch und bauliche Qualität Hand in Hand gehen. Das Projekt La Borda von Lacol wurde vor wenigen Tagen beim Mies van der Rohe Award 2022 mit dem Nachwuchspreis „Emerging Architecture“ ausgezeichnet.

In den letzten beiden Jahren haben viele Menschen ein größeres Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse entwickelt. Jetzt gilt es, neue Formen des Berufsalltags zu etablieren. Arbeiten an der Arbeit, könnte man auch sagen. Zusammen mit dem Team von baunetz id haben wir Produkte und Projekte ausgewählt, die zwischen den Sphären vermitteln. Zu entdecken sind unter anderem Apartments in Ljubljana und Bilbao, ein Konzeptbüro nach dem Lego-Prinzip oder eine Werbeagentur in Stuttgart, die sich auf drei Ladenlokale verteilt.

Hans-Walter Müller realisiert seit Ende der 1960er Jahre aufblasbare Architekturen. Doch seine Leidenschaft für Tragluftvolumen beschränkt sich nicht allein auf die Umsetzung temporärer Bauten. Müller lebt selbst seit 1971 in einer luftgetragenen Architektur.

In Zentral-Tokio mit seinen rund zehn Millionen Einwohner*innen wird bald eine Millionen Eigenheime leerstehen. Doch kulturelle, steuerliche und wirtschaftliche Gründe erschweren die Weiternutzung. Derweil entdecken immer mehr Initiativen aus der Architektur-, Kunst- und Immobilienszene das Potential des Bestands. Anne und Sebastian Groß stellen sechs von ihnen vor.

Kleiner Weltkurort mit großer Vergangenheit – und noch größeren Gebäuden: Bad Gastein südlich von Salzburg ist ein gebauter Ausnahmezustand zwischen Wasserfall und Spekulation, Romantik und Wintersport, Bergidyll und Felsenbrutalismus. Architektin Judith Eiblmayr und Fotograf Philipp Balga berichten im Gespräch von der Bau- und Kulturgeschichte des mythischen Ortes im Herzen der Ostalpen.

Im Schatten der Debatte über die Katholische Kirche verschwindet in Deutschland fast unbemerkt eine Jahrhunderte alte Lebensform: Die Ordensgemeinschaft. Mit diesem Wandel sind auch die teils denkmalgeschützten Klosteranlagen konfrontiert. In vielen Regionen werden sie derzeit umgenutzt oder verkauft. Wie kann die Transformation für Gebäude und Menschen gelingen?

Über ein halbes Jahrhundert lebte und arbeitete der gebürtige Franke Helmut Jahn in Chicago. Anfänglich orientierte er sich an Mies van der Rohe, später schuf er prägende postmoderne Bauten wie das ikonische State of Illinois Center, dessen Umbau aktuell debattiert wird. Oliver G. Hamm war in der Metropole am Lake Michigan, hat sich dort die Bauten Jahns mit frischem Blick angesehen und anschließend Werner Sobek gesprochen, mit dem Jahn ab den 1990er Jahren eine Reihe wichtiger Projekte realisierte.

Bis 2030 soll in der EU niemand mehr auf der Straße leben müssen. Dazu haben sich die 27 EU-Mitgliedstaaten vergangenen Sommer in Lissabon auf einer Konferenz zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit verpflichtet. Eine Ausstellung in München beleuchtet die Hintergründe der humanitären Krise und verweist auf die Rolle von Architektinnen und Architekten.

Seit der Wende verloren viele ehemals florierende, kleinere Städte in Ostdeutschland ihre Menschen. Nun entdecken engagierte Großstädter*innen das Potenzial der Freiräume. Zu Besuch in Wittenberge, Zeitz und Luckenwalde.

Für ein gelungenes Projekt müssen viele Voraussetzungen günstig zusammentreffen. Was dabei hilft, sind Architekt*innen, die sich geschickt im Bauprozess positionieren. Sei es mit einem ungewöhnlichen Bürostandort, strategischen Partnerschaften oder ambitionierten Auftraggeber*innen. Wir stellen elf Büros vor, die auf ganz unterschiedliche Weise gut gestalten.

Zoologische Gärten und Aquarien sollen heute nicht nur Erlebnisräume sein, sondern zum Nachdenken und Handeln motivieren. Sie muüssen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Zoologinnen, Besuchern und Tieren angemessen berücksichtigen. Das beeinflusst auch die Architektur. Insbesondere neue Aquarien sorgen in den letzten Jahren international für Aufsehen.

Um der gestiegenen Nachfrage bei Feuerbestattungen nachzukommen, beschloss die Regierung von Flandern vor 15 Jahren ein Bauprogramm, das in Europa seines gleichen sucht. Die sieben neuen Krematorien und ein Friedhof zeigen, wie zeitgenössische Bestattungslandschaften heute aussehen können.

Anfang Oktober eröffnete die Expo 2020 in Dubai. Nach dem Ende der Weltausstellung soll das Gelände erfolgreich nachgenutzt werden, behaupten die Veranstalter. Vergleichbare Pläne gab es auch bei der Expo 2000 in Hannover. Doch aus der versprochenen „Stadt der Zukunft“ wurde nichts. Ein Gespräch mit dem Fotografen Piet Niemann, der das ehemalige Expo-Gelände im letzten Jahr mit seiner Kamera erkundet hat.

Das ehemalige Tierversuchslabor der Freien Universität Berlin ist das sperrigste Baudenkmal der Stadt. Eine Nachnutzung des Sichtbetonkolosses erscheint schwierig. Mit dem „Modellverfahren Mäusebunker“ hat das Landesdenkmalamt Berlin einen offenen Prozess initiiert, der neue Wege der denkmalpflegerischen Debatte geht.

Wie kann Architektur klimagerecht werden? „Mit möglichst wenig Technik“ lautet die Antwort von vier Architekturbüros, die mit Pilotprojekten und systematischer Datenanalyse die Überlegenheit des Einfachen beweisen wollen.

Was steht für die Architektur der 1990er Jahre? Während die Immobilienwirtschaft den Baubestand längst munter überformt und aussortiert, hat es die Baugeschichte dieser Zeit in Forschungskreisen noch schwer und die Denkmalpflege kann kaum mithalten. Die Initiative „Best of 90s“ will die Debatte voranbringen.

How will we live together? Hoffentlich nicht nur digital. Die Biennale im zweiten Corona-Jahr macht deutlich, welche Relevanz Architektur und gebauter Raum haben. Ein Besuch in Venedig lohnt sich auch unter Pandemiebedingungen, wie unsere zwölf Empfehlungen zeigen.

In dieser Ausgabe versammeln wir Stimmen von jungen, deutschen Architekt*innen, die in den 1980er Jahren auf dem Land oder in der Kleinstadt aufgewachsen sind und sich nach ersten beruflichen Erfahrungen für die Rückkehr in ihre Heimat entschieden haben. Sie arbeiten in der Eifel und im Westerwald, in der Altmark, im Saarland, in Oberbayern und in Oberfranken. Vielleicht sind sie der Zukunft des Bauens näher, als man es sich in der Großstadt manchmal vorstellen mag.

Modellstadt Lyon: In den 1960ern trieb die Politik eine Autobahntrasse mitten durchs Zentrum. Heute hat sich die Stadt an Rhône und Saône als grüne Zukunftsmetropole neu erfunden. Was wesentlich zur hohen Lebensqualität beiträgt, ist ein starker Fokus auf den öffentlichen Raum.

Hoffnung Holz: Fast 200 Projekte wurden beim „Bundeswettbewerb HolzbauPlus 2020 – Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen“ eingereicht. Das ist mehr als je zuvor. Wir zeigen eine Auswahl der Preisträger*innen und bringen zwei Interviews zum Thema ökologisches Dämmen.

Wie viel Mies soll es sein: In Berlin und in Washington D.C. wurden zwei sanierungsbedürftige Bauten von Mies van der Rohe für weitere Jahrzehnte nutzbar gemacht. David Chipperfield Architects leiteten die Sanierung der Neuen Nationalgalerie. Mecanoo entwarfen den Umbau der Martin Luther King Jr. Memorial Library. Die Ansätze und Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein.

70 Jahre Eisenhüttenstadt: Nicht einmal eine anständige Feier gab es zum 70. Stadtjubiläum von Eisenhüttenstadt, der einst von der DDR so hoch gelobten „ersten sozialistischen Stadt Deutschlands“. Zeit für die Würdigung einer Stadt, die auf eine stolze Geschichte zurückblickt und dringender als viele andere nach einer neuen Zukunft sucht.

Die Berlinische Galerie präsentiert die Architektur der 1980er-Jahre mit Fokus auf beide Seiten der geteilten Stadt. Das letzte Jahrzehnt vor dem Mauerfall zeigt sich mit einer ausgesprochen experimentierfreudigen und widersprüchliche Vielfalt an Gebäuden und Gedanken.

Die Bauwirtschaft wird für rund die Hälfte des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich gemacht. Allein auf die Zementindustrie entfallen bis zu acht Prozent. Was bedeutet das für die Zukunft des Baustoffs Beton? Ein Lagebericht, innovative Ansätze aus der Forschung und Appelle an die Politik von Mike Schlaich, Regine Leibinger, Werner Sobek und Matthias Tietze.

Dicht bewachsene Fassaden und überwucherte Balkone sind derzeit vielleicht in Mode, aber kein neues Phänomen. Ein Blick zurück auf historische Formen von begrünter Architektur, lange vor dem heutigen Greenwashing.

Noch vor zehn Jahren kamen Architekturführer als funktionale Reisebegleiter daher. Heute gehen viele Publikationen gestalterisch und konzeptionell völlig neue Wege – und wollen als Bücher gelesen werden. Sieben bemerkenswerte Architekturführer für die halbe Welt und darüber hinaus.

Terrassenhäuser waren der ambitionierte Versuch, die Qualitäten des Einfamilienhauses mit eigenem Garten im Geschosswohnungsbau zu realisieren. Sie erlebten in den 1960er und 70er Jahren einen Boom, waren aber schon bald nicht mehr gefragt. Der Ruf nach verdichtetem Wohnen in der Stadt, die Bodenpreisentwicklung der letzten Jahre und die aktuellen Herausforderungen der Pandemie machen diese spezielle Typologie plötzlich wieder aktuell.

Kunststoffe waren einmal wichtige Innovationsfaktoren in Architektur und Design. Längst gelten sie als Umweltsünde. Wieviel ist übrig von der einstigen Faszination?

Mit viel Gespür für Sujet und Blickwinkel dokumentiert die Fotografin Irmel Kamp Architektur. Seit über vierzig Jahren widmet sie sich Besonderheiten des regionalen Bauens und lokalen Ausprägungen des Internationalen Stils. Ein digitaler Studiobesuch.

Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie schnell Veränderung geht, wenn es sein muss. Diese Ausgabe versammelt Menschen und Projekte, deren Ansätze und Haltungen zuversichtlich machen für alles, was kommt.

Es tut sich was in der niederländischen Architektur. Nachdem der Begriff „Superdutch“ und die radikale Hypermoderne 30 Jahre lang den nationalen Diskurs dominierten, bezieht sich eine junge Generation von Architekt*innen nun wieder stärker auf die prämodernen Traditionen.